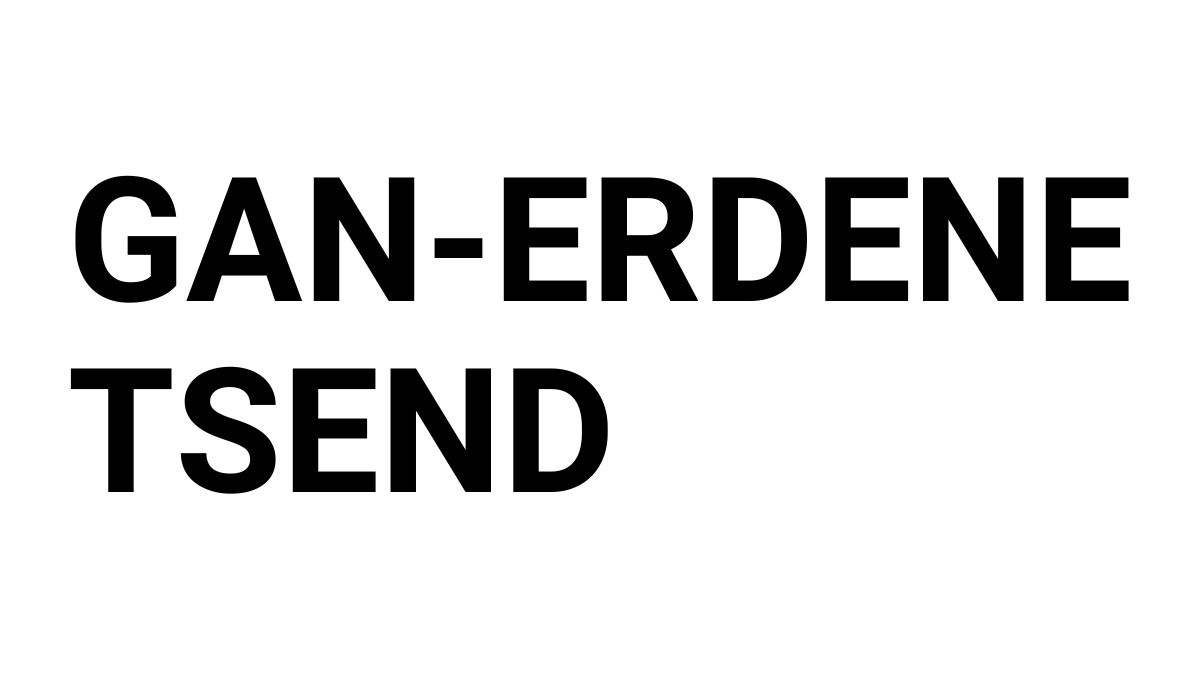Texts
Aloisia Föllmer
Eröffnungsrede zur Ausstellung „In einem anderen Leben“ Gan-Erdene Tsend
Kunsthaus Klüber, Weinheim, 06. Mai 2018
Es ist schon etwas Besonderes einen Künstler hier in Weinheim zu haben, der aus einer völlig anderen Welt kommt. Die wenigsten von uns kennen die Mongolei, wo er aufwuchs und 22 Jahre seines Lebens verbrachte.
Geboren in Murun, verbrachte er die ersten sechs Jahre in den Bergen und weiten Steppen am Rande der Wüste Gobi. Seine Naturverbundenheit und sein Traditionsbewusstsein, die in seinen Bildern deutlich zu spüren sind, können wir auf das Nomadenleben zurückführen. Ständige Begleiter seiner vier- Generationen-Großfamilie waren Pferde, Kamele, Schafe, Rinder und Ziegen. Vier Mal im Jahr zog die Familie mit allen Tieren durch die Wüste. Auf diese Weise hat der Maler, der viele Jahre mit seinen Großeltern in typischen Filzjurten lebte, die unendliche Weite der Mongolei, mit ihren Luft- und Lichtstimmungen (Dr. Dagmar Thesing), mit ihren Gerüchen und Temperaturen erlebt.
Gefühle von Vertrautheit, Geborgenheit und auch Erlebnisse der Erhabenheit der Natur verbindet er mit ihr.
Wie fremd muss ihm das Leben in Deutschland vorgekommen sein. Er, der zunächst fünf Jahre Kunst an der Universität der Hauptstadt Ulan Bator studierte, ließ sich hier in Deutschland, in Münster nieder und studierte weitere sieben Jahre lang an der Kunstakademie unter Professor Hermann-Josef Kuhna, durch den er seinen Umgang mit der Farbe intensivierte.
Seiner Heimat bleibt Tsend aber treu, denn seit 2009 ist er Mitglied des Verbandes mongolischer Künstler. 2006 erhielt er den Kunstpreis für junge Kunst und 2012 den Kunstpreis Wesseling.
Seit fast 10 Jahren zeigt er seine Bilder in Einzel- und Gruppenausstellungen in vielen deutschen Städten und in Holland. Hier in Europa, so weit weg, erinnert er sich an seine Heimat, indem er unseren zersiedelten Kulturlandschaften die unberührte Weite der Mongolei entgegensetzt. So nimmt denn auch die Landschaftsdarstellung einen bedeutenden Teil in seiner Malerei ein.
Wir werden auf vielen Bildern magisch von breiten endlosen Wegen und ihrem Tiefensog angezogen. Keine Menschen und Tiere stören den Blick. Es herrscht lautlose Leere. Wege verbinden wir damit, dass sie auf ein Ziel zustreben und dass Zeit nötig ist, um sie zu bewältigen. Und wir sprechen vom Lebensweg. Wege haben auch bei Tsend eine mit dem Leben verbundene symbolische Bedeutung.
Seine großformatige Landschaft mit dem bedeutungsschweren Titel „Mutter und Kind“ zeigt zwei Wege, der schmalere läuft parallel zum breiteren, er schmiegt sich ihm an, bis sich beide verbinden und ineinander auflösen. Leben erzeugt neues Leben, es setzt sich fort, trägt sich weiter.
Tsends flache Landschaften, die eine meditative Kraft entfalten, offenbaren den Zauber des Fremden, wenn Pferde und Menschen in ihnen zu sehen sind. Vielleicht belustigt über das Schild wie über das am Schild festgebundene Kamel sitzen vier Jungen ohne Sattel und Zügel auf dem Rücken eines Pferdes. Das Schild mit dem Reitverbot wirkt sinnlos, träge erscheint das grasende Pferd, öde die von Leere bestimmte Landschaft. Bewegungslosigkeit und Passivität paaren sich mit Stillstand, was durch das ironische Reitverbot unterstrichen wird. Es scheint irgendwie bei Mensch und Tier und insbesondere für die junge Generation nicht vorwärtszugehen. Sagt Tsend damit, dass die Freiheit der mongolischen Kinder ihren Preis hat?
Tsends Kunst kann man als eine Art Spurensuche auffassen. Mit ihr kreist er um seine kulturelle, soziale und emotionale Identität. Seine Bilder lassen erspüren, was es heißt, seine Heimat verlassen zu haben und in der Fremde zu sein. Denn tiefe oder hohe Horizonte erzeugen die Grenzlosigkeit von Wüsten und Himmel und bewirken Gefühle von Verlorenheit, Melancholie und Sehnsucht.
Der Künstler malt seine Bilder vorwiegend in altmeisterlicher Technik in Öl auf Leinwand.
Dabei ist auf vielen Bildern der Malvorgang als solcher im stellenweise pastosen oder pointillistischen Farbauftrag nachvollziehbar so z. B. an Gräsern, Steinen, Sand- und Erdklumpen.
Auf den ersten Blick wirken die Bilder realistisch und spielen doch ein faszinierendes Spiel mit dem Unrealistischen. Der märchenhaft auf der Wolke schwebende Angler, das Verschwimmen von Himmel und Wüsten, das zauberhafte wie auch verunsichernde Spiel der Doppelschatten, die die tanzenden Mädchen begleiten, all dies lässt Tsends Vorliebe für das Unwirkliche im Wirklichen erkennen. Seine fliegenden Menschen verkörpern die menschliche Sehnsucht, alle erdhafte Schwere zu überwinden. Indem Tsend die Ketten und Stühle des Karussells weglässt, können sich die Haltung der Oberkörper sowie die Gesten der Arme ungestört entfalten. Und wenn der Maler eine Frau samt Karussell-Stuhl neben der Freiheitsstatue auf Long Island abstürzen lässt, verbindet er das Schicksal amerikanischer Flüchtlinge der Geschichte New Yorks mit der heutigen Flüchtlingssituation.
Im Gespräch sagte er: „Die Flüchtlinge haben keinen festen Boden unter den Füßen, sie leben mit der Hoffnung auf Freiheit - zwischen Himmel und Erde.“ Tsends Schaukelnde und seine Wattwanderer sind einsame und ein wenig verträumte Gestalten, die ihren Gedanken nachhängen. Die Wattwanderer hat er an der Nordsee erlebt. Das Watt erinnert ihn an die grenzenlose Ebene der Mongolei, aber wie er sagt, „mit Wasser“.
Auf dem Watt läuft ein Kind auf eine große Wasserlache zu, in der das umgekehrte Bild einer abwesenden, fremdländischen Frau zu sehen ist. Ihre Erscheinung kommt dem Kind real vor. Auf diesem Bild, das links ein afrikanisches in einem kurzen Hemdchen und vielleicht ein europäisches Kind in Jeans zeigt, verbindet Tsend über alle Entfernung hinweg das deutsch-nordische Watt mit Menschen aus anderen Regionen der Welt. Die Spiegelbilder des Künstlers veranschaulichen die Bedeutung der Phantasie und des Unbewussten, ein Thema, das zu Beginn des letzten Jahrhunderts von den Surrealisten aufgegriffen wurde. Sie zeigen, dass „Gedanken… ihre eigene Realität“ haben, die das ganze Handeln und Fühlen der Menschen bestimmen. So tauchen zu den Hauptfiguren immer wieder auf dem Kopf gehende oder stehende Personen auf, mal sind sie ganz konkret, mal nur als Schemen und immer nur mit angeschnittenen Körpern zu sehen. Diese umgekehrten Personen, sind wie Spiegelbilder der Erinnerung. Gewesenes wird zurückgeträumt, wodurch die Bilder Gegenwart und Vergangenheit gleichermaßen atmen und dadurch nicht ohne Melancholie sind. Tsends Erinnerungsbilder offenbaren, dass das Bewahren bzw. die Auseinandersetzung mit Vergangenem der Selbstvergewisserung dient sowie Bindung und Identität stiftet.
Man kann die Spiegelungen aber auch als Wunschbilder, als Vorausträume deuten. Tsend, der die Verbindung von mongolischer Tradition und europäischer Identität verinnerlicht hat, hat damit eine Bildsprache entwickelt, die den Gegensatz von Nähe und Ferne, von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft überwindet. Und dies alles verkörpern auch die wie versunken in unschuldigem Weiß tanzenden Mädchen. Sie geben sich ganz dem Augenblick hin. Dieser enthält für sie das Bei-Sich-Sein, also die Gegenwart, wie auch die Hingabe an die Erinnerung (Vergangenheit) und den Traum (Zukunft).
BOLOR Tsolmon - Botschafter der Mongolei in der Bundesrepublik Deutschland
Eröffnungsrede zur Ausstellung „I will be your mirror“, Kolvenburg in Billerbeck 2016
Den in Deutschland tätigen mongolischen Maler TS.GAN-ERDENE kenne ich seit 2005, damals noch als Studierenden an der Kunstakademie Münster. Er ist ein verdienter Vertreter von mongolischen Kultur- und Kunstschaffenden, die in Deutschland ihre Ausbildung erworben haben. Es gibt diese Tradition seit fast 100 Jahren, als junge Mongolen nach Deutschland zwecks Studium und Ausbildung kamen. Herr TS.GAN-ERDENE hat 2009 in diesem Sinne an der gemeinsamen Ausstellung von mongolischen Malern (L.Namkhaitseren, Ts.Enkhjin) in Berlin anläßlich des 35.Jahrestages der Aufnahme von diplomatischen zwischen der Mongolei und der Bundesrepublik Deutschland erfolgreich teilgenommen, wo er mit vollem Recht die junge Generation allein vertrat.
Er erhielt 2014 die ehrenvolle Auszeichnung des Ministers für Bildung, Kultur und Wissenschaft der Mongolei als „Best Mongolian National Talent“.
Für die Völkerverständigung ist der Kulturauschtausch sehr hilfreich. „Soft Power“ ist heutzutage zu einem Schlüsselwort der auswärtigen Kulturpolitik der Mongolei geworden. Für die mongolische Botschaft in Berlin gilt daher die Arbeitsformel: je mehr positive Präsenz die Mongolei in der deutschen Öffentlichkeit und in den deutschen Medien erlange, desto mehr wird unsere diplomatische Arbeit dadurch erleichtert. Diese Zielsetzung der mongolischen Außenpolitik wird auch in der Zukunft verfolgt und finanziell untermauert, hoffentlich mit wesentlich mehr finanziellen Mitteln aus Mehreinnahmen von Rohstoff-Export-Erlösen als zum heutigen Zeitpunkt.
Herrn Ts.GAN-ERDENE wünsche ich gutes Gelingen seiner Ausstellung „I will be Your Mirror“ und viel Erfolg in der Zukunft. Bei der Gelegenheit danke ich recht herzlich auch im Namen der Mongolischen Regierung den Gastgebern der Ausstellung in Kolvenburg, den Amts- und Würdenträgern von Coesfeld und Billerbeck, und allen Freunden und Helfern, die am Zustandekommen dieser Ausstellung wohlwollend mitgewirkt haben.
Doris Götting MA
Tiefenschichten der Farben und des Lichts – Gan-Erdene Tsend und seine Bilder, Münster 2004
Vor gut zwei Jahren verschaffte mir ein Zufall – die Jahresausstellung der Studierenden der Kunstakademie Münster – die Begegnung mit dem jungen mongolischen Maler Gan-Erdene Tsend. Das große Atelier der Meisterklasse von Prof. Hermann-Josef Kuhna hatte ich aufgesucht, weil ich dort die Bilder einer japanischen Bekannten ansehen wollte, die derselben Klasse angehört. Doch mein Blick fiel zuerst auf eine Reihe fremdartig und zugleich vertraut wirkender Gemälde, die aus dem Gros der dort präsentierten Werke qualitativ hervorstachen: pointillistisch aufgelöste Flächen, die in ihrer sensiblen Farbigkeit das Auge magisch anzogen, um den Blick dann auf ein meist an den rechten oder linken Bildrand gesetztes realistisch wirkendes Motiv zu lenken - den Rückenakt einer am Meeresufer hockenden Frau zum Beispiel, Fuß- und Fahrradspuren im Schnee, die Spiegelung von Wolken in den Pfützen eines grasgesäumten Weges. Immer wieder waren Wege zu sehen, die sich am Horizont einer weiten Landschaft verloren. Manchmal verliefen sie leicht schwingend diagonal durch das Bild, manchmal führten sie direkt in die Tiefe, auf eine Horizontlinie knapp unterhalb des oberen Bildrandes zu. Diese Bilder sprachen mich unmittelbar an; das Westliche an ihnen wirkte leicht verfremdet, das Östliche seltsam vertraut. Mongolische Landschaften meinte ich in den rot, blau, grün, grau oder gold dominierten Malflächen zu erkennen, und so fragte ich dann den jungen Künstler, der ein bisschen scheu neben seinen Werken stand, ob er etwa Mongole sei. Er war es. So lernte ich Gan-Erdene Tsend kennen und lernte im Laufe der Zeit und vieler gemeinsamer Gespräche seine Bilder, ihre farbliche Qualität, ihren gedanklichen Tiefgang und ihren leisen Humor mehr und mehr schätzen.
Seine heimatlichen Wurzeln hat Gan-Erdene Tsend in Murun, der Hauptstadt des gebirgigen, wald-, wasser- und fischreichen Khuvsgul Aimag im Norden der Mongolei. Dort kam er 1979 zur Welt. Verwurzelt ist er auch weiter südlich, im Grenzgebiet zwischen dem Tuv Aimag und Dondgobi. Dort, wo die Steppe allmählich in die Stein- und Sandwüste der Gobi übergeht, verbrachte Gan-Erdene Tsend bei den Großeltern seine frühe Kindheit. Er ist aufgewachsen mit Kamelen, Pferden, Yak-Rindern, Ziegen und Schafen, den mongolischen Nomaden heiligen fünf Tierarten. Seinen künstlerischen Impetus genährt haben, neben dem ständig wechselnden Licht und den Farben der Steppe, auch die wundersamen Geschichten der Großmutter - Volksmärchen, die ihn heute noch gelegentlich inspirieren. Dann entstehen Bilder, auf denen ein Murmeltier, das einen archaischen, mit Holzlatten bepackten Yak-Karren lenkt, mit diesem Gefährt durch die Lüfte zu neuen Gestaden reist („Reise“, 2006) oder wo ein Murmeltier einem Kamel auf den Kopf geklettert ist und Ausschau hält („Wache“, 2007) – Erinnerungen an die in der mongolischen Erzähltradition so beliebten Tiergeschichten. Auch Anklänge an buddhistische Konzeptionen finden sich. Wenn Gan-Erdene Tsends Generation auch sozialistisch antiklerikal erzogen wurde, so waren es zumeist Großeltern, die den Enkeln religiöse Traditionen, oft genug heimlich, weitergaben und damit lebendig erhielten.
Seit 2001 lebt Gan-Erdene Tsend in Münster, wo er nach Absolvierung des obligaten Deutschkurses ab 2003 die Kunstakademie besucht und sich derzeit auf sein Abschlussdiplom vorbereitet. Münster in Westfalen ist eine schöne Stadt mit einer alten, reichen Geschichte, aber ihre Dimensionen sind andere als die der Mongolei. Münster ist überschaubar, klein. In Münster ist der Horizont begrenzt, im realen wie im übertragenen Sinn. Der Himmel ist niedriger, das Licht weniger strahlend, die Farben sind dunkler, erdiger, schwerer als in der Mongolei, die Menschen eher verschlossen. Was zog einen mongolischen Künstler ausgerechnet hierher? Dass die Wahl auf Münster fiel, war wohl auch ein Zufall. Gan-Erdene Tsend hatte nach Abschluss seines Studiums in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar wohl den Wunsch, zur Fortsetzung seiner Ausbildung nach Deutschland zu gehen, und er hatte Bewerbungsmappen nur Kunstakademie Münster eingereicht. Die einzige Einladung, die er daraufhin erhielt, kam von Kunstakademie Münster. Dass er die Einladung annahm, hat er nicht bereut. Für seine künstlerische Entfaltung hat sich Münster als geeigneter Ort erwiesen. Die Voraussetzungen für diese Entfaltung allerdings, eine solide „handwerkliche“ Basis, brachte er bereits mit.
In Ulaanbaatar hatte Gan-Erdene Tsend zuvor zehn Semester lang an der dortigen Hochschule für Bildende Künste bei Prof. Ts. Narangerel angewandte Kunst studiert, vor allem Wand- und Fassadengestaltungen mit den verschiedensten Materialien. Neben der Malerei waren dies vor allem Fresko, Mosaiken, Keramiken, Metallarbeiten und textile Gestaltungsformen. Das Schwergewicht lag auf der Vermittlung von Gestaltungstheorien, Materialkunde und der Einübung künstlerischer Techniken, handwerklicher Grundlagen künstlerischen Schaffens also. Dieses Studium - ein Ausbildungsgang, der in der Mongolei vom russisch-europäischen Akademiebetrieb alter Schule geprägt war - hat Gan-Erdene Tsend mit einem Diplom abgeschlossen. Damit hat er gegenüber seinen deutschen Kommilitonen einiges voraus, die meist direkt von der Schule, in der die musischen Fächer seit Jahren sträflich vernachlässigt werden, auf die Akademie wechseln. Dass an den Kunstakademien in Deutschland die Vermittlung künstlerischer Techniken gegenüber der Förderung von „Kreativität“ in den Hintergrund getreten ist, dass geschickte Pinselführung und Farbgebung allein längst nicht mehr als Ausweis künstlerischer Begabung gelten, dass die Schönen Künste nicht mehr unbedingt ästhetisch „schön“ sein müssen, das war für Gan-Erdene Tsend eine Erfahrung, die ihm, wie er in einem unserer ersten Gespräche freimütig bekannte, anfangs schon einige Probleme bereitet hat. Inzwischen weiß er aber damit umzugehen. Er genießt die Gestaltungsfreiheit, den Spielraum für seine künstlerische Weiterentwicklung, die ihm in einem solchen Umfeld zur Verfügung stehen. 2007 ernannte ihn Prof. Kuhna zu seinem Meisterschüler.
Zur Jahresausstellung 2007 der Kunstakademie Münster steuerte der junge Künstler neun großformatige Arbeiten bei, die den gewachsenen Mut zum eigenen Ausdruck, den freieren Umgang mit überkommenen Bildvorstellungen belegen. Die in Deutschland gemalten Bilder kommen, wie er sagt, „mehr vom Herzen, aus dem eigenen Inneren“. Bildtitel - wenn er sie gibt - drücken Gedanken und Gefühle aus. Sie lauten: „Begegnungen“, „Erwartung“, „Ruhe“, „Einsam“, „Gefahren“, „Unendlichkeit“, „Einöde“. Es sind Titel, die auch Lied- oder Gedichtüberschriften sein könnten. Andere wiederum verweisen auf Farbwerte: „Blau“, „Goldschmied“, „Greenland“, „Sonnenuntergang“, „Warmregen“, um nur einige zu nennen. Warme Farben dominieren denn auch, vom dunkel verschatteten Rot bis hin zu gleißenden Sonnenfarben, sich vielfach brechend, in zahllose Farbpartikel zerfallend und dennoch aufeinander bezogen, locker neben- und übereinander geschichtet. Im Gemälde „Warmregen“ (2006) zum Beispiel fällt ein tiefes Rot und wandelt sich am Boden zu Blau und mit einigen Lichtern versehenem Grau. In der erst unlängst fertig gestellten Arbeit „Tau“ (2008) ist hinter der blau dominierten Nachtkühle bereits die rötliche Wärme der aufgehenden Sonne spürbar, die den Tau rasch zum Verschwinden bringen wird. Selbst da, wo der Gesamteindruck ein distanziertes Grau zu sein scheint, finden sich versteckte Rottöne, so in gegenständlichen Werken wie Schneebild „Spuren“ (2005) und „Mama, wo bist Du!“ (2008), auf dem ein Kamelfohlen nach seiner Mutter Ausschau hält.
Ihre Leichtigkeit beziehen Gan-Erdene Tsends Arbeiten daraus, dass immer wieder auch der Malgrund und die Textur der Leinwand durchscheinen. Tritt der Betrachter einige Schritte vom Bild zurück, fügt sich das differenzierte Farbspiel wieder zu Landschaften. Entfernt lassen sie zwar noch an die Steppenlandschaften der Mongolei denken, doch hat sich längst ihre Verwandlung in Seelenlandschaften vollzogen, die ihr Aussehen je nach Lichteinfall oder Tageszeit oder auch nach persönlicher Gestimmtheit ständig ändern. Zwar sind Motive aus der mongolischen Heimat in Gan-Erdenes Bildern immer noch stark präsent, aber der Künstler hat sie aus ihrem vertrauten Kontext herausgelöst und so eine ganz eigene Bildsprache gefunden, die mit Folklore nichts mehr zu tun hat. Eindrückliches Beispiel ist sein 2005 entstandenes Werk „Erinnerung“, auf dem er das bekannte mongolische Märchen von der Entstehung der Pferdekopfgeige in Verbindung bringt mit der persönlichen Erinnerung an den eigenen Großvater. In diesen neuen Kontext gehört geradezu sinnbildlich auch das bereits erwähnte Werk „Reise“ (2006) - ein Bild, das außerdem Selbstironie und Humor verrät. Auch seine neue Umgebung hat Gan-Erdene Tsend künstlerisch in den Blick genommen. Münsters Kirchtürme und die reizvolle ländliche Umgebung der Stadt gehören zu den Motiven.
Es sind Bilder, die anzuschauen man nicht müde wird. Seine Pinselführung ist präzise, aufs Detail gerichtet und dennoch verträumt, schwebend. Manche seiner „inneren Landschaften“ wirken in der Aufsicht so, als sei der Künstler selbst beim Malen einige Meter über dem Boden geschwebt. Die wenigen Menschen, die er malt, sind meist nicht „geerdet“, ihre Füße hängen entweder in der Luft wie bei dem kleinen Nomadenjungen, der er selbst gewesen sein kann („Schüler“, 2008), wie bei dem Großvater-Bild „Erinnerung“. Oder sie sind von Wasser umspült („Meerjungfrau“, 2006) – Erscheinungen, die wie der Tau jeden Moment wieder verschwinden, sich auflösen können.
Diese Bilder, und die eher auf ein dahinter Stehendes verweisenden Titel wirken aufschlussreich in ihrer Verschlossenheit, sie sind hermetisch und offensichtlich zugleich. Der Nacktheit seiner weiblichen Akte fehlt jeder Aufforderungscharakter. Entweder kehren sie dem Betrachter den Rücken zu, oder – im Falle des Gemäldes „Der Kuss“ (2008) – es bietet sich eine im Sand liegende, die Erde küssende Schwangere nicht dar, sondern wirkt ganz in sich gekehrt, dem in ihr keimenden Leben zugewandt. Die dezente, ins grau-grüne changierende Farbigkeit dieses Aktbildes hat etwas von der anziehenden Nüchternheit der Stillleben Giorgio Morandis, während die mehr kontemplativen, „abstrakten“ Werke in ihrer Thematik wie auch in ihrer pointillistischen Technik an manche zen-buddhistisch inspirierten Meditationsbilder Mark Tobeys denken lassen. Beide Richtungen beschäftigen den jungen Künstler zur Zeit gleichermaßen. Welchen der beiden Wege er letztlich einschlagen wird, muss man der Zukunft überlassen.
An vielen Ausstellungen in Münster und Umgebung und darüber hinaus in anderen Städten Deutschlands hat sich Gan-Erdene Tsend inzwischen beteiligt. Im April 2008 hatte er in der Galerie das Weltkabarett der Kunstmetropole Düsseldorf eine gut besuchte Einzelausstellung seiner neueren Werke. Und auch mit einer Auszeichnung kann er aufwarten. 2006 erhielt er den zweiten Preis für Junge Kunst der KUBOSHOW, einer von der Stadt Herne veranstalteten Kunstmesse im Revier, auf der alljährlich das Publikum über die Preisträger abstimmt.
© Doris Götting
Zur Autorin:
Doris Götting stammt aus einer Münsteraner Künstlerfamilie. Journalistin (Hörfunk und Printmedien) mit langjähriger Ostasien-Erfahrung. 1994-2003 Präsidentin der Deutsch-Mongolischen Gesellschaft e.V. (Bonn). Lebt inzwischen wieder als freie Autorin in Münster.
Dr. Gregor Jansen, Direktor Kunsthalle Düsseldorf
„munkh khukh tenger" oder ewig blauer Himmel
Aus dem Katalogtext von Gregor Jansen: Zur Malerei von Gan-Erdene Tsend, 2020
Wir flüsterten. Ganz leise und behutsam gingen wir ein wenig vom Ger-Camp in die offene Steppe. Es war angenehm heiß, ein leichter Wind wehte und der Himmel war gleißend blau. Die weißen runden Zelte der Nomaden duckten sich in die leicht geschwungene Hügellandschaft und es war weit und breit nichts zu sehen, kein Mensch oder Tier, kein Auto oder Vogel, kein Geräusch. Es war so wunderbar still, dass die eigene Stimme wie ein Schrei in der Wüste klang, wie ein Fremdkörper inmitten des gewaltigen Eindrucks gegenüber dieser unendlich scheinenden Landschaft und Natur, gegenüber dieser unfassbar ungewohnten Geräuschkulisse, die pure Ruhe war. Wir fühlten uns wie auf dem Mond, oder Mars, jedenfalls war das nicht die Erde, die wir kannten. Als Reisende in der Mongolei weilten wir bereits eine Woche in der Hauptstadt Ulaanbaatar und hatten die Ausgrabungsstätten Karakorum, für „schwarze Berge“, „schwarzer Fels“, „schwarzes Geröll“, die ehrwürdige Hauptstadt (1235–1260) des Mongolischen Reiches am Fuß des Changai-Gebirges besucht und das Polospiel im malerische Orkhon-Tal bestaunt. Dieses Tal ist eine beeindruckende Kulturlandschaft 300 km südlich von Ulaanbaatar aus sanften grünen Hügeln an den Ufern des Orkhon Flusses nördlich von Kharakhorum. Als ehemaliges Machtzentrum der Mongolen und Sitz der Hauptstadt Dschingis Khans beinhaltet das Orkhon-Tal prachtvolle Städte, Klöster und historische Artefakte - seit 1992 als 2.000 Jahre altes Nomaden-Land zum Welterbe der UNESCO. Wir lieben dieses Land und die Menschen dort, ihre Kultur, die Nomaden wie die Städter – die Mongolei gilt als das dünnstbesiedelte Land der Erde. Es hatte uns vom ersten Moment an in den Bann gezogen.
Die Mongolei ist ein typisches Hochplateau mit einer durchschnittlichen Höhe von 1.600 m über dem Meeresspiegel. Zwei Drittel des mongolischen Territoriums sind ohne Abfluss in die Weltmeere. Durch das Land verläuft die Kontinentalwasserscheide Asiens vom Mongolischen Altai über das Tannu-Uul-Gebirge, den Khangai-Gebirge, und die Ostmongolei zum Khingan-Gebirge, und trennt die Entwässerungsgebiete zum Nordpolarmeer und zum Pazifischen Ozean vom zentralasiatischen Binnenentwässerungsgebiet. Die Landoberfläche zeichnet sich durch beeindruckende Vielfalt aus – undurchdringliche Wälder, hohe Berge, Flüsse, Seen und Waldsteppen im Norden und Nordwesten, weite baumlose Steppen, Wüstensteppen und Wüsten im Osten, Südosten und Süden, ewiges Eis und zahlreiche Gletscher in den Hochgebirgslagen des Mongolischen Altai, der sich im äußersten Nordwesten vom Russischen Altai löst und in Richtung Südosten in den Gobi-Altai übergeht. Im Mongolischen Altai finden sich außer Wüsten und Gebirgstaiga alle in der Mongolei vorkommenden Landschaftszonen: Wüstensteppe, Steppe, Gebirgssteppe, Gebirgswaldsteppe und die alpine Hochgebirgsregion.
In den Gemälden von Gan-Erdene Tsend finden sich all diese Eindrücke wieder. Seine Landschaften sind von einer beinah unerträglichen Leichtigkeit des Sein geprägt, von einer Art Anti-Gravitation durchzogen, die bei Menschen und Tieren meist in Rückenansicht über der materiellen Welt schweben. Die ewigen langen Fahrten über unbefestigte Straßen und die Orientierungslosigkeit inmitten GPS-freien Geländes jenseits der gewohnten Zivilisation faszinieren Touristen wie auch Künstlerinnen und Künstler, die jenseits der existentiellen Grundbedingungen der Nomaden diese Landschaften und ihre Menschen erleben und betrachten. „Heimweg“ ist ein Beispiel aus zahlreichen Querformaten, die nur die Pisten zeigen, die das weite Land durchziehen und den Pfaden der Tierherden eine zweite Fahrspur hinzufügen. Der Weg ist das Ziel und die Doppelspur der Piste das stundenlange Orientierungszeichen einer nahezu orientierungslosen Topographie. Das karge rauhe Leben mit klirrend kalten Wintern wie trocken heißen Sommer wird geprägt durch die Viehzucht von Pferden, Rindern, Ziegen, Schafen und Kamelen. In „Insel“ von 2020 steht eine Pferdeherde wie um eine Tränke eng gedrängt in der Leere, in einer spiegelnden, nackten weiten Szenerie. Isolation inmitten einer Gruppierung.
Beinahe surreal wirken auch die losgelösten Personen in seinen Gemälden im urbanem Kontext, die ebenfalls wie aus Raum und Zeit gefallen Menschen auf spiegelnden, flirrend heißen oder nassen Untergründen zeigen, die als Reflexionsebene mitunter optische Illusionen bergen, wie bei „Bridge“. Aber auch bei „dance“ von 2018 und noch deutlicher bei den Gemälden „Karussell“, 2018 und 2019, und „heroes“, 2016, werden die Kräfte der Gravitation durchbrochen und eine Leichtigkeit kommt ins Bild, die von der Freiheit und erstaunlicherweise Erdverbundenheit erzählen, die Gan-Erdene Tsend aus seiner Heimat Mongolei einprägsam erfahren hat. Das erkennbare New York, oder die Freiheitsstatue, stehen im komplementären Gegensatz zur menschenleeren Landschaft dort. Das gigantische, von dunstig Grau bis zum strahlenden Blau reichende Himmelszelt, mit einem ebenso beeindruckend sternenklaren Nachthimmel, ist auch im mongolischen Schamanismus ein fester Begriff. Der am meisten verehrte Gott ist neben anderen "Tenger" (Himmel; Gott des Himmels) und wird auch manchmal als "munkh khukh tenger" bezeichnet, was "ewig blauer Himmel" bedeutet. So verwundert es nicht, dass in den Bildern von Gan-Erdene Tsend die Erde wie der Himmel in endlosen Perspektivfluchten und mit einer vollkommen natürlichen Unendlichkeit auf etwas unbestimmt Bestimmtes verweisen.
Der Wunsch nach einer totalen Versenkung in die Kräfte der Elemente und der Natur, einer einzigartigen Landschaft und der wenigen Menschen und Tiere in ihr, lässt uns innehalten und still werden. Demütig schauen wir in den Kräften der Malerei in ihre Wirkkraft, und ich glaube, man darf sagen in ihr Herz, in das Herz des Künstlers Gan-Erdene Tsend.
Frank Schablewski, Schriftsteller
Aus dem Katalogtext von Frank Schablewski: in Gan-Erdene Tsend, Reality is just an Illusion, Münster 2022
Ist die Realität gerade, soeben, genau, gerade noch oder einfach eine Illusion? Realität bezeichnet singulär die Wirklichkeit, die tatsächliche Lage, eine Gegebenheit. Im Plural ist sie ein anderes Wort für Grundstücke und Grundeigentum. Die Illusion dagegen ist die beschönigende, dem Wunschdenken entsprechende Selbsttäuschung über einen in der Wirklichkeit nicht so positiven Sachverhalt. Die Psychologie spricht sogar von einer falschen Deutung tatsächlicher Sinneswahrnehmungen. Gan-Erdene Tsend hätte keinen schöneren Titel für seine Ausstellung finden können. Die Leinwand als Grundstück, noch nicht erworbenes Eigentum und darauf das Spiel der Sinneswahrnehmungen, wo es doch heißt, dass alle nur sehen können, was sie bereits kennen.
Gan-Erdene Tsend ist nach Deutschland gekommen nach seinem ersten Kunststudium in Ulaanbaatar in der Mongolei, um an der Kunstakademie in Münster bei dem Professor Hermann-Josef Kuhna den Realismus zu hinterfragen, den er im ersten Studium zur Perfektion erlernt hat. Im Ausland werden die eigenen Prägungen sichtbarer und auch wertvoller, das erfährt jeder Mensch, der sich auf einem fremden Terrain, in einer fremden Sprache bewegt. So überrascht es nicht, in den Bildern von Gan-Erdene Tsend die Weite wie die Leere zu finden, in welche er die Menschen, Tiere und Gegenstände komponiert. Pferdebilder mit und ohne Menschen, Spiegelbilder, die Menschen an Wasserflächen zeigen, und Landschaftsbilder stellen die zentralen Motive seines bisherigen malerischen Werkes dar. Es sind Bilder, die die Grunderfahrungen des Malers reflektieren. Ein Spiegel ist eine Vorrichtung, die einfallendes Licht entsprechend zurückwirft, reflektiert. Die Spiegelbilder von Gan-Erdene Tsend werfen ein Licht in die Betrachtung, das in der Zukunft wie in der Gegenwart und der Vergangenheit zu leuchten scheint. Das Seiten- verkehrte – ein Begriff der Reflexion – weist darauf hin, dass etwas nicht ganz richtig zu sein scheint. Ein Buch steht verkehrt herum – auf dem Kopf – oder ein Pullover wird verkehrt herum angezogen – mit der Innenseite nach außen. In der Sprache der Mystik ist ein Spiegel ein Symbol für Gott, als Spiegel der Ewigkeit, und für Christus, aber auch für die Seele. Im Schinto galt der Spiegel als Unterpfand von der Sonnengöttin Amaterasu, der achteckig bis heute eines der Heiligtümer des Schreins von Ise ist. Der Spiegel ist ferner ein Sinnbild göttlicher Allwissenheit und als solches mit dem aztekischen Gott Tezcatlipoca (= rauchender Spiegel) verbunden. In Magie und Märchen beantwortet der Zauberspiegel Fragen. Bei Reh-, Rot- und Damwild bezeichnet der Spiegel den weißen bzw. heller gefärbten Fleck um den After. Es ist eine Schutzfärbung beim Äsen, da so der Eindruck entsteht, es stünde dort nur ein gefällter Baum.
Derart versteht sich möglicherweise das Selbstporträt Gan-Erdene Tsend malt einen Pferdeschädel, der auf einem Silbertablett liegt, mit dem Essensbesteck auf jeder Seite. Im Hintergrund sieht man Malspuren, als würde sich hier das Motiv der Zeit spiegeln in der verlaufenen Farbe. Der Realismus ist ein Zeichen des Augenblicks. Jedes Verwischen, jeder Farbenverlauf bedeutet schon seine Verlängerung. In der lateinischen Sprache bedeutet anima „Seele“, nach C.G. Jung „Frau im Unbewussten des Mannes“ und im Münzwesen den aus unedlem Metall bestehende Kern einer mit Edelmetall überzogenen Münze und animal, das die aktive Lebensäußerung betrifft, das Reagieren auf Sinnenreize, die Fähigkeit zu willkürlichen Bewegungen, meint, auch in der Bedeutung „animalisch“, also „tierisch, den Tieren eigentümlich, triebhaft, urwüchsig-kreatürlich“. Der Totenschädel eines Pferdes spannt somit einen weiten Bedeutungskanon, vom Sinnbild der Seele, der Herabsetzung des Wertes eines Tieres in der modernen Welt, sowie ein Tierzeichen zu sein, das die Wildheit verkörpert, auch wenn nur noch in der Erinnerung. Hier taucht ein Grundgedanke des Künstlers Gan-Erdene Tsend auf, es kann keine Gegenwart geben ohne die Reflexion, die nicht nur ein Zurückwerfen von Licht bedeutet, sondern auch ein Begriff für das Nachdenken ist, die Überlegung, Betrachtung, in der das Denken vergleicht und überprüft, um einen Gedankengang zu vertiefen. Das Besteck wie der Silberteller sind Zeichen der Zivilisation, die dem Bild des Tierschädels als menschliches Zeichen der Verfeinerung gegenüberstehen. Ein Selbstporträt ist dieses Ölbild, als läge die Wildheit eines Wesens nur noch als Kadaver vor, aber es bespiegelt wie ein Memento mori jede Äußerungen des Lebens.
Das Tier – das Pferd wie das Kamel – zeigt in Bildern wie die Beziehung zum Menschen wie insbesondere Tsends Arbeit. In der deutschen Sprache gibt es diverse Redewendungen, die das Glück eines Menschen beschreiben, wie das beste Pferd im Stall zu sein oder wie ein Pferd arbeiten zu können. Das Ungeschick beginnt damit, dass man ein Pferd beim Schwanz aufzäumt. Mit jemandem Pferde stehlen zu können, beschreibt vielleicht das eigene Gefühl in der Betrachtung der beiden reitenden Jungen, wobei ein Junge sich zum Horizont dreht, als wäre er Teil des Jungen, der die Zügel hält wie sein Spiegelbild. Das rote Hemd spiegelt ein Blau. Die Jungen haben vier Beine wie das Pferd selbst. Sie sind so komponiert, als verschwämmen ihre Körper zu einem. Der Bildgrund zeigt nichts, nicht einmal einen Horizont, von dem es heißt, er sei die Heimat von vielen, ein Sehnsuchtsort. Die Kraft der Pferde ist jedoch hilflos gegenüber dem menschlichen Willen, wo es heißt, keine zehn Pferde könnten jemanden dazu bringen, etwas zu tun. Wie steht diese Redewendung der Anzahl von Pferden, der nicht gesattelten Herde gegenüber? Ruht hier nicht eine Kraft, die den Willen eines Menschen geradezu in Luft auflöst? Die Ruhe, das Innehalten ist eins der großen wie starken Motive in der Malerei von Gan-Erdene Tsend. Dass den beiden Jungen in dem Bild das Pferd durchgeht, ist nicht zu erwarten, vielmehr hat der Künstler die beiden auf das richtige Pferd gesetzt, um die Kraft der Natur auszuloten, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen, das Glück zu erleben, das angeblich auf dem Rücken der Pferde liegt. Eine Paraphrase zu Rilke sei hier erlaubt, um sich dem Reiz der Malerei von Gan-Erdene Tsend zu nähern: In dem Himmel ohne Schatten dreht sich eine kleine Weile der Bestand von hellen Pferden, alle aus dem Land, das lange zögert, eh es untergeht. Keines ist an Wagen angespannt und in der Erhabenheit ihrer Mienen geht niemand mit ihnen, sie stehen allein auf fast weißem Sand. Jedes Bild besitzt die Ruhe einer Andacht, einer Meditation, in der Beschaulichkeit wie Besinnlichkeit. Dieses Geschehen in einer leeren Welt ist uns möglicherweise fremd, da diese Leere hier nicht einmal mehr auf dem Land zu erleben ist. Die Wüste ist in unserer Kultur ein Entstehungsort der Religionen. Gan-Erdene Tsend malt die Natur und darin den Menschen als Teil von ihr, vielleicht ginge er ohne das Tier in ihr verloren. Das ist ein durchaus mystischer Aspekt in der Bildwelt des Künstlers.
Die Leere seiner Landschaftsbilder strahlt diese mystische Stille auch aus. Die Wege, Wagenspuren, Fußpfade lösen sich im Horizont auf, als wäre diese waagerechte Linie das Ziel allen Gehens. Die Vegetation überrascht und hat nichts von der europäischen Agrikultur. Die einzigen Furchen dieser Landschaftsbilder sind Wegmarken, die in der Betrachtung vor den eigenen Augen liegen, als noch zu bewältigende Aufgabe. Die Erde ist im Abendland zumeist weiblich konnotiert. Gan-Erdene Tsend nennt eines seiner Landschaftsbilder „Vater“, als wäre das Gehen ein männliches Attribut und damit der Boden männlich besetzt. (Im Louvre in Paris zeigt ein ägyptisches Paar den Mann in der Pose des Gehens und die Frau in der Pose des Stehens.) Was ist der Weg eines Menschen? Geht er vom Horizont weg oder auf ihn zu? Auf den Landschaftsbildern scheint der Horizont fast immer auch als Bildgrenze. Die Gattung der Landschaftsmalerei wurde erst im 15. Jahrhundert bildwürdig. Ihre Bedeutung wuchs mit dem zunehmenden Bedürfnis nach Illusion. Der malerisch-illusionistische Landschaftsraum wurde zum Ausdrucksträger religiös-numinoser Naturanschauung. Den religiös-numinosen Aspekt bricht Gan-Erdene Tsend in eine persönliche Beziehung auf, indem er sein großes Bild mit dem Wort „Heimweg“ betitelt. „Weg“ und „weg“ ist ein Polysem, Gang wie fort sein.
Das Karussell ist eine wichtige Bildidee in dem bisherigen Werk des Künstlers. Wie auf einem Zifferblatt im Uhrzeigersinn stehen die Körbe, in denen die Menschen sitzen, ohne Ketten, die sie halten, und schweben im freien Raum. Die Figuren in den Bildern sind dem Zauber eines Karussells nicht entwachsen. Mitten in einem Schwung schauen sie auf, irgendwohin, hinüber in einer festgehaltenen Drehbahn. Das bleibt „und eilt sich nicht, da es nicht endet. Es kreist weiter und dreht sich still und hat kein Ziel“. In seinen Bildern „wird ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, ein kleines kaum begonnenes Profil, manches hergewendet, etwas seliges, das blendet und sich verschwendet in diesem atemlosen, blinden Spiel“. Trotz der Höhe gibt es keine Abgründe, als wäre es die Hand des Künstlers, die das Fallen – wenn – ganz sanft halten würde. Worte von Rilke in seiner dichterischen Sprache, die auch noch nach über hundert Jahren gelten. Der Künstler setzt seine Figuren keinerlei Gefahr aus, sondern zeigt mit jeder einzelnen Gestalt das Bodenlose, das Kunst bedeutet, den fantastischen Traum einer Existenz ohne befestigte Sitzgelegenheit, ohne bewegliche Vorrichtung und mit dem Gefühl der Freiheit und Ungezwungenheit in diesen Laufbahnen des Lebens. Himmel, Küstenverläufe tauchen Wolken wie Freiheitsstatuen auf, wie erzeugt mit dem Wahrheitsgehalt einer Fata Morgana, die umso wirklicher erscheint, als die Bedürfnisse zunehmen. Wie setzt der Künstler eine Wolke in den Himmel und warum? Үүл (Üül) heißt im mongolischen Wolke, Үүр (Üür) Morgengrauen, Morgendämmerung wie auch Nest und Horst. Die Wolke ist in ihrer Gestalt leicht veränderbar. Sie wäre ein Horst der Träume. In ihr ließe sich so viel sehen. Die Blicke der Figuren, die Mutter und Kind zu sein scheinen, gehen ins Blaue vom Himmel, einer Farbe, die in einer Redewendung mit der Unwahrheit gepaart wird. Was ist das Vertraute und was ist das Ungewisse? Hochpoetisch entwirft hier Gan-Erdene Tsend seine Bildwirklichkeit.
Dem Himmel gegenüber steht das Meer wie ein Spiegel des Blaus, in der Wirklichkeit ist es im Wasser dunkler als in der Luft, als wäre jedes Gewässer tiefer. In den Bildern von Gan-Erdene Tsend verschwimmen Himmel und Wasser, da er sie in ähnlichen Farben malt, wie um eine Grenze aufzuheben, als wäre das tiefe Wasser, der ferne Himmel nichts als ein weiterer Schatten in seinen Bildern. In den Bildern geschieht ein surrealistischer Akt, in den gemalten Spiegelungen sind zusätzliche Figuren zu sehen. Es entsteht somit ein Blick in die Zukunft oder die Vergangenheit, ein Blick in die Welt der Wünsche und Träume. Hier passiert die Illusion, von der Gan-Erdene Tsend sagt, sie sei auch eine Wirklichkeit. Ein Kinderspiel beginnt mit den Zeilen, „ich sehe was, was du nicht siehst, das ist“. Für den Künstler sind Vergangenheit und Zukunft keine grammatikalischen Zeitformen. Das Schamanentum wird in der Verwandtschaft des Künstlers ausgeübt. „Ahnen“ und „ahnen“ spiegelt in der deutschen Sprache weiterhin diese frühe Form der Religion. Die Zukunft wird in Bildern als Zusammenkunft dargestellt. Die Einsamkeit, das Alleinsein der einzelnen Gestalten scheint somit nur gegenwärtig zu sein. In seinen Bildern sind Zeichen von Architektur, dem Sinnbild der Stadt, zu sehen, in denen sich die Schatten oder Figuren spiegeln. Die Entstehung von Städten ist eng verknüpft mit der Vorbereitung und Entwicklung vermeintlich moderner Gesellschaften. Das Leben in größeren Städten führt zu Differenzierungen, zur Arbeitsteiligkeit der Bevölkerung in zentralen Funktionen in Handel, Kultur und Verwaltung. Die allgemeinen Voraussetzungen waren ein erhebliches Bevölkerungswachstum und rationellere, arbeitsteilige Wirtschaftsformen. Wie tanzt es sich dann ganz allein auf einer Bildfläche? Erinnerungen an die Kindheit werden wach, wo ein Spiel „Himmel und Hölle“ auf die Straße gekreidet wurde, wo Kinder Steine werfen auf Felder, in die sie dann hüpfen müssen. Als wäre die Wirklichkeit vereinfacht ein Gegensatz wie „Himmel“ und „Hölle“, da sie scheinbar nur so in ihrer Komplexität begriffen werden kann. Die Spiegelung schafft derart ein Gegenüber, ein Gegenteil der jeweiligen Person. Stadt bedeutet die Verteilung von Schutz, Gütern, Herrschafts- und Kultfunktion. Wie doppelt schön, das Motiv der Brücke, die zwei Ufer mit- einander verbindet. Vor die Mitte einer Brücke malt Gan-Erdene Tsend Frauen, die vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder Universität sind. Im Wasser spiegelt ein männliches Pendant, ein Kind, das gegenwärtige Alleinsein, aber auch die selbstständige Bewältigung eines Weges, der Zeichen der Überbrückung ist, nicht nur Infrastruktur.
Ein alltäglicher Moment bekommt eine tiefere Bedeutung. Das Wort „Seele“ in der deutschen Sprache beinhaltet das Wort „See“. In der altnordischen Sprache bezeichnet das Wort für Seele auch die flache Stelle eines Sees, wo in der nordischen Mythologie die Seelen von der Milchstraße auf- und absteigen, wenn sie zur Welt kommen oder die Welt verlassen. Im Englischen gibt es den unreinen Reim soul and shoal, „Seele und Untiefe“. Das ist der Hintergrund, warum die Bilder von Gan-Erdene Tsend so eine starke Wirkung haben. Sie sind ein Spiegel für die Menschen, die sie betrachten. In der Wiederholung der Motive liegt die Gefahr der Gewohnheit. Die feinsinnigen Variationen fesseln jedoch. In Tsends Bild spiegelt sich im Fenster nicht nur das Kind, sondern auch die Figur einer älteren Frau, zu der das Kind aufzuschauen scheint, als wäre die übergroße Figur ihre Großmutter, die sanft zurückschaut. Wer ist wer in dem Spiel der Spiegelungen? In Versailles und anderen Schlössern gibt es Spiegelsäle, um den wirklichen Raum zu vergrößern, jeden Menschen zu vervielfachen. Die Spiegelungen in den Werken von Gan-Erdene Tsend zeigen eine Bildwirklichkeit, die viel größer und intensiver scheint als die Wirklichkeit außerhalb der Leinwände.
Prof. Dr. Ferdinand Ullrich, Museumsdirektor Kunsthalle Recklinghausen
Zur Malerei von Gan-Erdene Tsend, Recklinghausen, 2007
Die Bilder von Gan-Erdene Tsend sind weit, tief und endlos. Sie sind so, wie wir uns die mongolische Heimat des Künstlers vorstellen: einsame, flache Landschaften ohne Abwechslung ohne dramatische Ausblicke – spannungslos. Für die klassische Landschaftsmalerei bieten sich nur wenige Anreize: keine Bäume, keine Flüsse, kaum Menschen, nur Wüste und Steppe. Dies ist keine Vorlage für die europäische „heroische“ Landschaft. Aber die ausgewogene Komposition von Vorder-, Mittel- und Hintergrund als Grundlage einer ausgefeilten Bilddramaturgie im Verhältnis zur Bildflächenordnung hat seine Gültigkeit für zeitgenössische Künstler ohnehin verloren. Was dann aber interessieren kann, ist die Differenz von Bild und empirischer Wirklichkeit. Die Frage aller gültigen Kunst muss also lauten: Was gibt es nur im Bild? Wo unterscheidet sich das gemalte Bild von der – in welcher Form auch immer – nur optisch wahrgenommenen Wirklichkeit?
Auch wenn man mit einigem Recht an die deutsche romantische Malerei denken mag, so ist der Unterschied doch offensichtlich. Die Präsenz des Erhabenen im Bild geschieht dort zum einen im Modus der radikalen Form, in die die Landschaft als repräsentative gebracht wird – bei Caspar David Friedrich etwa oder im Modus einer radikalen Symbolik – bei Philipp Otto Runge zum Beispiel. Immer aber ist es hier in der deutschen Romantik das Naturvorbild, das auch im Detail nachvollziehbar ist, so sehr es auch synthetisiert sein mag. In der zeitgenössischen Variante von Tsend ist aber die Malerei selbst ein nicht zu übersehendes Moment, das allen Naturalismus des bloßen Augeneindrucks hinter sich lässt – eine Erfahrung der abstrakt-konkreten Kunst des 20. Jahrhunderts.
So hat eine solche motivische Ödnis, die sich Tsend zum Ausgangspunkt genommen hat, einen anderen, künstlerisch durchaus fruchtbaren Reiz. Schon die Landschaft selbst schafft ein Bewusstsein des Verhältnisses von illusionistischem Raum und konkret-malerischer Fläche. Die Differenzierung geschieht wesentlich auf der zweidimensionalen Bildfläche als Auseinandersetzung mit der Malerei und ihren Variationsmöglichkeiten, wobei die Farbe in diesem Prozess eine besondere Rolle spielt. Die Naturfarbigkeit wird durch eine konsequente Kunstfarbigkeit ersetzt und bis ins Künstliche übersteigert. Zugleich wird auch der individuelle Duktus kultiviert, indem der einzelne Pinselstrich bewusst sichtbar gehalten wird. Er zeigt sowohl landschaftliche Struktur wie Gras, Stein, Sand als auch die Spur eines künstlerischen Individuums, das sich an einer Bildvorstellung und nicht so sehr an einer Wirklichkeitsvorstellung abgearbeitet hat. Diese über die Farbe bewirkte Auslöschung des Landschaftlichen zugunsten der abstrakten Wirkung der Farbe erzeugt eine innere Seelenlandschaft. Der Ausweis des Humanen ist also weniger im Motiv als in der Malweise zu finden. Diese ist eben nicht eine bloß naturalistische, die eine bestimmte Wirklichkeitserfahrung im Bild zu kopieren versucht. Landschaftserfahrung wird in eine spezifische Bilderfahrung übertragen.
Menschen scheinen nicht in diese Bildlandschaft zu gehören. Wenn sie doch zum Bildmotiv werden, so sind es doch mehr Erscheinungen, als sei ihre Existenz nur als solche möglich.
Wo nichts ist, muss man sich etwas erfinden. Die Phantasie ersetzt die karge Wirklichkeit durch Bildvorstellungen, mit Mythen. Eine „Meerjungfrau“ hockt in einer rot glühenden Weite, als sei sie gerade der Erde entstiegen und zugleich auch der reinen Farbmaterie entsprungen. Ein mongolischer Hirte steht im Sfumato des Bildes und versinkt aber als kompositorisches Bildelement zeitgleich im einheitlichen Farbklang.
Im Medium der Malerei verbindet sich so bei Gan-Erdene Tsend Tradition und Moderne, Malerei und Wirklichkeit, Heimatgefühl und Weltläufigkeit zu einer sehr besonderen, eigentümlichen und dennoch gegenwärtigen, also gültigen Malerei.

Greenland, 2007, 90x110 cm, Öl auf Leinwand, © Gan-Erdene Tsend
Prof. Dr. Raimund Stecker, Lehrt Kunstwissenschaft an der HBK, Essen
doppelt fremd vertraut
Mein Nachname ist der Vorname meines Vaters, mein Vorname der Nachnahme meines Kindes
Aus dem Katalogtext von Raimund Stecker: Zur Malerei von Gan-Erdene Tsend „I will be your mirror“, 2016
Landschaften – weite, ferne, fremde, ungekannte… Endlosigkeiten und Unnahbarkeiten… Verlorenheiten und Einsamkeiten… Hohe, nahe Himmel und tiefe Horizonte sowie flache, weite Himmel und nie zum Greifen nahe Horizonte… Eingefasste Wolkenfelder und zu ihnen strebende Erd-Äther-Ungrenzen - untrennbar ineinander übergehende Streifenvermittlung zwischen Erde und Luft… 360 Grad Flachheit, immer eine von Bildrand zu Bildrand sich erstreckende, wenn auch ab und an „nur“ zu imaginierende Horizontlinie… Rundum Fläche, den Betrachter stets in die Mitte eines Kreises verortende Unbehaustheit… Einöden, Verhaltenheiten, Ruhen, Stillen, Verträumtheiten, Unwirtlichkeiten und Harmonien in Monotonieen… Monochromieen, Eintönigkeiten, Gleichförmigkeiten und sfumato-verwobene Ineins von Uneinheitlichem…
Nur vereinzelt ein Point de Vue – mal eine Person, mal ein Pferd, mal ein enges Zusammen vieler Pferde, sogar mal ein Holzbau, mal ein sich verlierender Weg, mal ein entrückter Gebirgszug, mal ein flaches Wasser, eine Pfütze, ein in ihr Angelnder. Feuchte Trockenheiten, die Perversion eines Verbotsschildes in der Mitte eines Nirgendwos,… Bewegtheiten mögen sich ereignen, doch vorscheinende Unbewegheit überschleiert diese. Die Anfangsszene aus Roman Polanskis „Wenn Katelbach kommt“ (Cul de Sac) spiegelt sich ein. Warten, warten, warten, warten, warten – am Ende der Strasse, dort, wo sich ihre linke und rechte Begrenzungslinie ihren Berührungen annähern, am Horizont, scheint sich etwas zu bewegen. Handlungen wirken so entschleunigt. Kommunikation schleicht sich wortlos, nonverbal, geräuschlos, pianissimo vonstatten. Unaufgeregtheit flächentief…
Und dann Irritationen im Eingesehenen, im alsbald - aufgrund von Bildgewohntem - schon vermeintlich Gewohnten: Spiegelungen von Zweien, obschon nur einer sich spiegelt – Spiegelungen von einer, gleichwohl zwei da sind. Fest sitzend Fliegende im endlosen Raum, Gefestigheit im freien Fall, Sich-Bewegende – alleine bei sich, in sich ruhend… Fata morganen gleiche Rückspiegelungen, die unnahbare Fernen in noch weitere Fernen entrücken…
Gan-Erdene Tsend malt solche Gesichte, solche Visionen, die nur als solche zu bezeichnen sind, weil zumindest mir die Erfahrungen fehlen, sie als Gesehenes, als irgendwo wahr Genommenes, als Wahres zu verstehen. Das bildlich Vorgestellte ist nicht als außerbildlich zu Kennendes wiederzuerkennen. Mangels Erfahrung ist nicht zu behaupten, dass es zu den Bildern andernorts Vor-Bilder gibt, dass es zu den Motiven für den Bildbetrachter entsprechende Motive für den Maler gegeben hat. Realitäten scheinen so vorgestellt, die „nur“ gleichsam als Surrealitäten zu verifizieren sind. Folglich sind eigentlich nur außerbildliche Irrealitäten zu behaupten, solche, die allein in den Bildern Realität geworden sind.
Es sind „Unrealitäten“, um den Begriff einzuführen, der sich in Gan-Erdene Tsends Wortschatz eingenistet hat. Mithin werden wir auch fortan von Unrealitäten in seinen Bildern zu sprechen haben. Sie sollen, so der Künstler, seine Kindheitserinnerungen, seine Rückblicke an ferne und lang zurückliegende Erfahrungen und Nach-Träume in seine Bildwelten spiegeln. Fakten und Dinge und Gedanken und Phantasien werden so Bilder. Sein Leben spiegelt sich folglich in seine Bilder so ein, wie sich Vorstellungen in Erfahrungen einspiegeln können: kaum unterscheidend zwischen Gewesenem und daraufhin Erträumtem. Der Maler selber sagt, dass die Unrealitäten „zu mir gekommen sind“.
Diese gleichsam abstrakte Komplexität muss immer mitgedacht werden, will man sich dem vertraut Fremden in diesen Bildern nähern. „Gedanken haben eine eigene Realität“ sagt Gan-Erdene Tsend. Darum wohl auch wirken die Bilder nicht unvertraut, aber doch immer auch befremdlich unkennbar. Der Betrachter sieht sich in seine Bilder ein, doch fehlen ihm (selbstverständlich auch ihm) eben die Erfahrungen vom Dargestellten, um in Erinnerungen, um im Kennbarem rückzubindende Sicherheiten über das bildlich zu Sehende zu erlangen. Sie bleiben mithin Bilder, obgleich sie vordergründig sehr wohl vorgeben, auch Abbilder sein zu können.
Über das Fremde der Motive zu sprechen sei fortan Geografen, Ethnologen und Reiseschriftstellern überantwortet. Hier soll interessieren, wie im vermeintlich Gesicherten von Darstellungen das Abstrakte des Bildlichen in Bildern zum Aufscheinen kommt. Dazu sei es empfohlen, Abstraktion nicht nur als die Reduktion von Gegenständlichkeit hin zu reinen Bildformen zu verstehen, sondern vor allem als das Zu-Denkende, zu dem es keine dingliche, keine gegenständliche und folglich auch keine sichtbare Entsprechung gibt.
Die Mongolei ist zumindest dem Schreiber dieser Zeilen eine terra incognita. Jedwede Vorstellung von ihr ist ihm eine medial Vermittelte. Keine Verifikation der Bildweltlichkeit mit einer Außerbildwirklichkeit dort ist ihm möglich. Jedes Bild ist für ihn nur als Bild zu sehen. Er weiß vom Maler, dass dieser bis zum sechsten Lebensjahr als Nomadenjunge durch die Wüsten gezogen ist. Vier Mal im Jahr zog er mit seiner Vier-Generationen-Familie und mit ihren Kamelen, Schafen, Rindern und Ziegen weiter mit Jurten durch die Wüste Gobi. Man lebte von Tauschgeschäften. Im Sommer wurden es windig-schattenlose 20 Grad plus, im Winter baute man sich festere Bleiben, um die minus 40 Grad überleben zu können.
Aus dieser Welt stammen die Bilder Gan-Erdene Tsends. Sie stellen Fremde vor und wirken dennoch nicht unvertraut. Aus der Bilderwelt der Kunst sind wir es gewohnt, vorgestellter Fremde bildlich vertraut zu begegnen. Und dieses Phänomen ist begründet. Denn der Kanon der gelehrten Geschichte von Kunst in der Mongolei umfasst auch die Werke der Russischen Wandermaler wie die der Europäischen Kunst, umfasst Ilja Repins Bilder und auch die Kunst Albrecht Dürers, umfasst die Sensationen des „Blauen Reiter“ und die der „Brücke“.
Dieses Wissen um die Kunst aus Deutschland und Europa motivierte Gan-Erdene Tsend, aus Ulan Bator nach Münster zu ziehen. So mag es auch erklärbar sein, warum uns die Bilder Gan-Erdene Tsends vertraut fremd daherkommen. Vertraut, weil sie den zeitlos ihrer Motivwelten entlehnten Bildauffassungen von Landschaft beispielsweise eines Jan van Goyens (oder auch denen des noch älteren Piero della Francescas, Caspar David Friedrichs oder im 20. Jahrhundert eines Balthus) nicht unähnlich sind, und so fremd, weil die historisch entfernten Motivwelten des Niederländers aus dem 17. Jahrhundert mit den geografisch fernen des Mongolen korrespondieren.
Für den Maler aus der Mongolei ist Malerei, ist Kunst, ein - wenn nicht sogar: das - Lebensmittel. Malen ist existentiell. Hermann Josef Kuhna, sein aus Düsseldorf stammender Lehrer in Deutschland, unterstützte ihn in diesem Essential künstlerischer Existenz. Dessen gegenstandlose Bildwelten suggerieren bildliche, Gan-Erdene Tsends gedankliche Ferne. Jedweder kunstbetrieblich-manifestiert ästhetische Imperativ wäre hierbei folglich nur delikat. Ihm verweigert sich Gan-Erdene Tsend auch fundamental. Selbst wenn er installativ arbeitet, wenn er Hufeisen klingen lässt oder skulptural fasst, ist jedes Jota aus seiner Person heraus sinnaufgeladen. Sich auszudrücken, sich mitzuteilen, sich zu äußern, ja: sich zu entäußern, seine Sichten freizugeben, sich mit seinen Gesichten zu entblößen und dies uns zu zeigen – wo, wenn nicht in der Kunst ist Raum für all das? Gan-Erdene Tsend unternimmt dies – und das unentfremdet. Seine Bilderwelten wirken so gesehen vertraut und sind gleichwohl doppelt fremd: historisch und geografisch – darin liegt ihre Aktualität: sie vertrauen auf der zukunftsbasierten Zeitlosigkeit von Kunst.
Prof. Hermann-Josef Kuhna, Kunstakademie Münster
Abstraktionen der Wirklichkeit: Gegenständliche Bilder, 2009
Eins der herausragenden Themen der Malerei von Gan-Erdene Tsend ist die Landschaft. Wir vermuten mit Sicherheit zu Recht, dass es sich um Erinnerungen an die Ebenen seiner mongolischen Heimat handelt dennoch reicht diese Vermutung zur Würdigung der Kunst nicht aus.
Denn die Tableaus wirken oft träumerisch – unwirklich. Dennoch stimmt es, dass Landschaften, vor allem die, die wir nicht kennen, oft ungeahnte Farben annehmen können.
Hier ist die Schnittstelle zwischen Traum, Sehnsucht und Wirklichkeit, die eine scheinbar unendliche Vielfalt der farbigen Interpretationen zulässt. Die Malerei zeigt ständige strukturierende Fließbewegungen die Farben grenzen sich manchmal gegeneinander ab, andererseits beobachtet man oft schnell hintereinander vermalte übergängige Bildpartien. Dadurch lassen sich Hilfsmittel zur Herstellung von Perspektive gewinnen: Im Vordergrund eines Bildes kann eine grünliche Malspur noch die Gestalt einer Pflanze in etwa wiedergeben, etwa an einem Wegesrand, in der Ferne spricht uns nur noch ein grüner Schimmer in diesem Zusammenhang an.
Oft ist der Horizont der Landschaftsbilder sehr hochgelegt. Eine sogenannte Vogelperspektive wird gewählt, wodurch der surreale Eindruck verstärkt wird. Es ist so, als erlebe man in einem Zeitraffer das Überfliegen einer Ebene bis z.B. an einem Gebirgsrand. Das die Dimension des Mythischen und Geschichtlichen erfasst kann Gan-Erdene Tsend durch die Darstellung von Personen, die aus einer anderen Zeit zu kommen scheinen. Ein alter Mann mit einem für uns Europäern exotisch wirkendem Instrument dazu immer wieder das Yaktier oder als Gespann ein Murmeltier tragend, banale Dinge – in der Erinnerung an die Heimat vermischen sich deren wichtigen Repräsentanten. Die exzellente Farbwahl der Bilder – eher möchte man sagen, ein Farbgefühl auf traumhaftem Niveau bestechen durch einen feinen Duktus, der nur durch extreme Sensibilität für das Material zu erklären ist, So nimmt uns Gan-Erdene Tsend mit auf eine Zeitreise, in der die Malerei Kunst ist und Kunst Malerei sein darf, ohne ihre klassischen Seiten zu verraten.
Warmregen, 2006, 110x90 cm, Öl auf Leinwand ©Gan-Erdene Tsend
Regine Wolff, Vorsitzende BBK Osnabrück e.V.
Eröffnungsrede zur Ausstellung „Zwei Welten“ Gan-Erdene Tsend
Kunstverein Melle e.V., Melle, 25. August 2023
ZWEI WELTEN ist eine sehr schöner und passender Titel, wenn ein Maler aus der der Stadt Mörön in der Mongolei, der in Münster lebt, hier in Melle ausstellt. Viel mehr als den Anfangsbuchstaben scheinen seine beiden Welten erst einmal nicht gemein zu haben. Mörön, der Geburtsort von Gan-Erdene Tsend ist eine Stadt von etwa 40 000 Einwohnern im Norden der Mongolei. Wenn wir den Ort in Google Maps eingeben und eine Route von Melle aus suchen, erhalten wir folgende Information: „7.646 km (95 h ) Auf der Route gibt es eine Sperrung. Es sind keine Alternativen vorhanden. Prüfe die Bedingungen, bevor du dich auf den Weg machst. Diese Route verläuft durch mehrere Länder. Dein Ziel liegt in einer anderen Zeitzone.“ Wir könnten ergänzen: Das Ziel liegt in einer anderen Welt.
Gan-Erdene Tsend ist 1979 in dieser anderen Welt geboren und kam 2001 für das Malerei Studium nach Münster. In diesem Jahr hat der Künstler genau gleich lang in beiden Welten gelebt, 22 Jahre in der Mongolei und 22 Jahre in Deutschland. Beide Einflüsse lassen sich in seinen Arbeiten und dieser Ausstellung beobachten. Zu erkennen ist dabei auch, dass die ersten 22 Jahre für Gan-Erdene Tsend, natürlich die prägenden waren – seine erste Welt. Die Mongolei ist das am dünnsten besiedelte Land der Erde. Auf einem Quadratkilometer leben durchschnittlich 2 Menschen, in Deutschland sind es 236. Die meisten Menschen der Mongolei leben in den wenigen Städten, 43 % allein in der Hauptstadt Ulaanbaatar. Wer in der Mongolei die Stadt verlässt, begibt sich in eine menschenleere Weite, die von der Landschaft des Hochplateaus geprägt ist.
Zitat: „Es war angenehm heiß, ein leichter Wind wehte und der Himmel war gleißend blau. Die weißen runden Zelte der Nomaden duckten sich in die leicht geschwungene Hügellandschaft und es war weit und breit nichts zu sehen, kein Mensch oder Tier, kein Auto oder Vogel, kein Geräusch. Es war so wunderbar still, dass die eigene Stimme wie ein Schrei in der Wüste klang, wie ein Fremdkörper inmitten des gewaltigen Eindrucks gegenüber dieser unendlich scheinenden Landschaft und Natur, gegenüber dieser unfassbar ungewohnten Geräuschkulisse, die pure Ruhe war. Wir fühlten uns wie auf dem Mond, oder Mars, jedenfalls war das nicht die Erde, die wir kannten.“ (Dr. Gregor Jansen, Kunsthalle Düsseldorf)
In dieser Landschaft hat der Künstler Gan-Erdene Tsend seine Kindheit verbracht. Während seine Eltern in der Hauptstadt Ulaanbaatar studierten, lebte er bis zu seinem siebten Lebensjahr bei seiner Großmutter, die als Nomadin nahe der Stein- und Sandwüsten der Gobi mit ihren Schafen, Ziegen, Pferden, Rindern und Kamelen den Jahreszeiten folgend umherzog, und nur die Wintermonate in einem festen Quartier verbrachte. Diese Großmutter war es auch, die Gan-Erdene Tsend die traditionellen Märchen und buddhistischen Legenden lehrte. Die Bilder Gan-Erdene Trends atmen diese Landschaft, diese Weite des Himmels, diese Freiheit seiner Kindheit und sind erfüllt von einem leisen unwirklichen Zauber, der sich bei ruhiger Betrachtung immer mehr entfaltet. Das größte Bild der Ausstellung, zeigt nichts als einen Weg und zieht uns direkt hinein und die weite helle Steppenlandschaft aus der der Künstler kommt. Mit scheinbar unendlich vielen warmen Farbnuancen in leicht und gleichzeitig dicht und voluminös aufgetragener Ölfarbe, fängt er Licht und Weite seiner heimatlichen Landschaft ein. Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, ich würde mich am liebsten auf diesen Weg machen, hineinlaufen in diese endlose Landschaft oder noch lieber - reiten. Denn was wir hier sehen ist eine mongolische Straße, ein Weg, der den Boden nicht versiegelt sondern offen und hell zu Tage treten lässt; ein breiter Pfad, der sich für Füße und Hufe scheinbar besser eignet als für Autoreifen. Er führt geradeaus bis zum Horizont und eigentlich weiter bis in den hellen flirrend wolkenlosen Himmel. Wie eine Startbahn liegt dieser Weg vor uns.
Gegenüber sehen wir ein Bild dieses hohen weiten Himmels und der Maler lässt uns mit seinen Figuren darin schweben. Im Raum gegenüber gibt es zwei weitere dieser Flug-Bilder. Die Fliegenden beschreiben noch den Kreis des Karussells, doch die Begrenzung durch die Technik ist verschwunden. Die Figuren sind wie traumhaft Reisende zwischen den Welten. Vielleicht ist diese Art des Flugs die einzige Möglichkeit ein Gefühl der Freiheit und Grenzenlosigkeit zu erfahren, das dem der weiten Steppe gleicht. Vielleicht lassen sich durch so einen Flug die 7.646 km traumartig überwinden und für einen Moment schweben wir dann über einer hellen sandigen Straße in einer unendlichen weiten Steppe auf unserem Morgenflug. (Bild im Raum gegenüber)
Das Licht und die für uns unwirklich weite Landschaft seiner Kindheit, die Märchen und der Zauber dieser anderen Welt leuchten in jedem Bild des Malers Gan-Erdene Tsend , selbst wenn er eine urbane Szene in New York zeigt.
Ein wichtiges Element in den Bildern die der Künstler für uns schafft, ist die Idee der Spiegelung. Dabei geht es Gan-Erdene Tsend nicht um den Effekt, die Sensation mit der die hyperrealistische Malerei uns so gern verblüfft. Der Künstler spielt in seinen in meisterhafter Leichtigkeit gemalten Bildern mit der Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Erwartung. So bereitet uns der Maler die Freude der Entdeckung. Er fügt dem Erwartbaren das Geheimnisvolle hinzu, das uns im Moment des Findens zu Eingeweihten macht. So erzählt er uns von Sehnsüchten und vom Getrenntsein, dass ein Leben in zwei Welten mit sich bringt.
Der Künstler selbst sagt über seine Arbeit: „Meine Kunst ist immer auch ein Spiegel meiner eigenen Lebenserfahrungen, die ich in meinen Werken in unterschiedlicher Form verarbeite. So hat mich das nomadische Leben, das ich in meinen ersten Lebensjahren inmitten der Natur der Mongolei führte, tief geprägt. Auch die Trennung von meiner Heimat, durch meine Ausreise nach Deutschland, gab mir wichtige Impulse für meine künstlerische Arbeit. Die Idee der „Spiegelung“ reflektiert genau diese biografische Situation. Als visuelles Mittel entstand sie aus meiner Vorstellung heraus, dass jeder Mensch in sich zwei verschiedene Leben vereint. Ein ideelles, welches in den Gedanken, der Fantasie und der Erinnerung des Menschen stattfindet, und ein dingliches, welches sich in der Realität, im Körperhaften, abspielt. Die Spiegelung ist dabei eine Metapher, mit der ich diese Gedanken der dargestellten Person, ihre Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte vergegenständliche. Auf diese Weise bietet mir die Spiegelung die Möglichkeit, diese beiden Leben, diese innere Gedankenwelt und die äußere Dingwelt, im Bild einander gegenüber zu stellen und sie so aufeinander zu beziehen. Die zwei verschiedenen Realitätsebenen decken durch ihre Gegenüberstellung die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung auf. Das, was an sich getrennt ist, kann ich im Bild mittels der Spiegelung wieder vereinen. In ihrer Differenz zwischen dem, was ist, und dem, was war oder sein wird bzw. sein könnte, kommt aber auch immer ein Verlust zum Vorschein. Denn in der „realen Welt“ fehlt immer eine Person, die in der Spiegelung auftaucht. Durch das Unkörperliche des Spiegelbildes wird ihre visionäre Dimension hervorgehoben.“
Wenn wir die Bilder von Gan-Erdne Tsend betrachten, kommt zu allem Versinken in der Atmosphäre der Bilder auch immer die Bewunderung für eine in der zeitgenössischen Malerei eher seltene handwerkliche Perfektion und einer Liebe zur Gegenständlichkeit, die an deutschen Kunstakademien gerade nicht so oft zu sehen ist. Bevor Gan-Erdne Tsend in Münster Kunst studierte, wurde er bereits ab 1986 in einer Talentschule in Ulaanbaatar vier Jahre lang in traditioneller mongolischer Zeichnung unterrichtet. Ab 1996 studierte er an der Universität für Kultur und Kunst in Ulaanbaatar und erwarb die handwerklichen Fähigkeiten der klassischen und dekorativen Malerei. Sein Studium an der Kunstakademie in Münster erstreckte sich noch einmal über 9 Jahre von 2001 bis 2010. Das er den Akademiebrief mit Auszeichnung erhielt möchte ich nicht unerwähnt lassen, aber ehrlich gesagt hatte ich nach der Betrachtung der Bilder nichts anderes erwartet.
Heute haben wir hier im Engelgarten in Melle das Vergnügen die meisterhaften Bilder von Gan-Erdene Tsend zu betrachten. Wir treffen ihn an einem Punkt seines Künstlerlebens den er zu gleichen Teilen in seiner fernen und in seiner neuen Heimat verbracht hat. Wir treffen ihn als einen Wanderer zwischen ZWEI WELTEN.
Stephan Trescher
Eröffnungsrede zur Eröffnung der Ausstellung: Gan-Erdene Tsend - Zwei Welten in der Akademie Franz Hitze Haus, Münster, am 5. Juli 2016
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Wo fängt man an mit so einer Rede, bei so vielen unterschiedlichen bildlichen Eindrücken? Man greift zum nächstgelegenen Rettungsanker – und das ist der Titel; nicht nur dieser Ausstellung, sondern gleich mehrerer Gemälde von Gan Erdene Tsend, also offenbar auch ein wiederkehrendes Thema seiner Kunst: „Zwei Welten“.
Normalerweise finde ich ja eine kunstgeschichtliche Betrachtung, die sich an den Lebensumständen des jeweiligen Künstlers entlanghangelt und damit das Werk erklären will, höchst unseriös und völlig entbehrlich. Paradebeispiel im schlechtesten Sinn ist dafür bekanntermaßen Picasso, dessen stilistischer Wandel meist mit seinen wechselnden Frauengeschichten respektive Ehepartnerinnen erklärt wird (als hätte er erst eine Frau in Blau, dann ein rosa Mädchen, schließlich eine eher würfelförmige Gattin, dann wieder eine klassisch runde gehabt etc. pp.). Gemeinhin lässt sich das Werk eines Künstlers also aus seiner Biographie nicht hinreichend erklären.
Im Fall von Gan Erdene Tsend muß ich aber konzedieren, daß seine Kunst überdurchschnittlich viel mit seinem Leben zu tun hat. Wenn es nicht so absurd bis böse klänge, könnte ich ihn glatt als einen Heimatmaler bezeichnen. Damit kommen wir auch schon an einen entscheidenden Punkt: Wenn überhaupt, dann ist Tsend nämlich ein Maler zweier Heimaten, eben zweier Welten. Schlicht gesagt: Der Mongolei, dem Land seiner Herkunft und Deutschlands, seiner zweiten Heimat, wo er studiert und seine Familie gegründet hat.
Aber ganz so einfach geht es eben dann doch nicht. Es gibt Motive in seinen Gemälden, die lassen sich eindeutig der einen oder anderen Welt zuordnen, aber schon jedes einzelne Bild für sich enthält eigentlich immer schon beides, ist also ein Brückenschlag, ein weltumspannendes Unterfangen. Der Künstler selbst vergleicht sich mit einem Zugvogel, der auf zwei Kontinenten lebt und beide seine Heimat nennt.Trotzdem kann er wohl das Gefühl der Heimatlosigkeit, der Entwurzelung besonders gut nachvollziehen, das heutzutage mehr Menschen betrifft als je zuvor, unzählige Individuen, die wir gewohnt sind nur als „Problem“ wahrzunehmen; Menschen die buchstäblich in der Luft hängen (bzw. hängen gelassen werden) und keinen Fuß mehr auf die Erde bekommen. Genau das, was wir auf der Einladungskarte zu dieser Ausstellung sehen. Diese Entwurzelung, dieses Aus-der-Erde-gerissen-Sein sieht man an den Verlaufsspuren flüssiger Farbe, die wie Schmutz noch an den Füßen einiger dieser fliegenden Menschen hängen. Noch schweben sie, sie würden so gerne zur Landung ansetzen und können es nicht. Dabei ist die Landung doch ohnehin das Schwerste. Die durchaus auch vorhandene Leichtigkeit des Motivs kommt natürlich daher, daß die in gerader Formation herabschwebenden Menschen dort erkennbar wie in einem unsichtbaren Kettenkarussell unterwegs sind - sie fliegen im Sitzen und ihre Hände, sofern sie sie nicht nacheinander ausstrecken, halten unsichtbare Schaukelseile oder eben Ketten fest.
Die meisten von uns werden das Gefühl kennen, in einem Kettenkarussell zu sitzen, sich allmählich in den Himmel zu schrauben, es verleiht einem ein wirklich schwebendes Gefühl, vielleicht auch einen leichten Schwindel, eine ungeheure Weitsicht, Dynamik und zugleich Stabilität durch die Ketten oder durch den möglicherweise vorhandenen Nachbarn im Nebensitz, dem man die Hand reichen kann.
Das gleiche Gefühl ohne Kette, ohne Sitz und ohne Zentrum, um das man sich dreht, erscheint demgegenüber schon reichlich unangenehm, jedenfalls hochgradig verunsichernd.
Diesem Bild am nächsten verwandt scheint mir das Gemälde der Frauen auf Schaukeln zu sein. In bläulich grauen und bräunlichen Tönen, farblich sehr zurückhaltend bis trist gehalten, sehen wir drei Frauengestalten in dünnen weißen Kleidchen auf Schaukeln sitzen oder kauern. Der Raum, in dem sich das Ganze abspielt und der sicher nicht von ungefähr dem Atelier des Künstlers ähnelt, steht teilweise unter Wasser; in der unregelmäßig verlaufenden, flachen Pfütze spiegeln sich alle Frauengestalten (von denen schwer zu sagen ist, ob es nicht Wiederholungen ein und derselben Person sind). Die eine beugt sich mit ausgestrecktem Arm weit nach unten und hält sich mit der anderen Hand am Schaukelseil fest. Daß das eine seltsam kompakte Rückenfigur ergibt, ist das künstlerisch spannende daran. Auf inhaltlicher Ebene wird aber besonders an dieser Figur das Prekäre an diesem Auf-der-Schaukel-Sitzen deutlich. Das heißt, auch hier, wo wir die Sitzmöglichkeit erkennen können, sie nicht im Unsichtbaren belassen wird, ist das Sitzen ein Balanceakt, wie immer bei Tsend. Entweder als Balancieren auf einem schmalen Balken oder als Sitzen auf einer Schaukel oder eben dem fliegenden Sitz eines Karussells. Das Höchstmaß an Sicherheit bietet noch das Sitzen auf dem Rücken eines Pferdes, was zugegebenermaßen für mich persönlich sicher der gefährlichste Aufenthaltsort von allen wäre, aber auch bei Tsend nicht immer ein Ort zum Ausruhen ist, wenn er beispielsweise gleich vier Kinder auf einem Pferderücken versammelt - kurz gesagt: Keiner seiner Protagonisten, sofern sie sitzen, hat Boden unter den Füßen und ihre Position ist stets eine zwischen Schweben, Stürzen, Fallen und Fliegen. Aber nicht nur der jeweilige Protagonist, auch der Betrachter von Tsends Kunst wird verunsichert: Wenn sich ihm die sichtbare Welt plötzlich als Negativumkehrung präsentiert, oder aber, um endlich auf das zentrale Motiv in Tsends Oeuvre zu sprechen zu kommen, wenn sie sich in Wasserflächen spiegelt. Denn die zu erwartende Verdoppelung findet im Bild nicht statt.
Eigentlich blicken wir nämlich nicht in einen Spiegel, sondern dahinter:
Bei Tsend sieht man im Spiegel nicht etwa weniger als in Wirklichkeit (das ist in Filmen mit Vampiren ja immer wieder ein gern genommener Moment schreckhafter Erkenntnis), sondern man sieht mehr. Nicht mehr Falten und Runzeln an sich selbst, sondern mehr und andere Menschen.
Das ist schon bei den erwähnten Schaukelfrauen so, aber augenfälliger noch in anderen Gemälden. Ein besonders schönes Beispiel dafür scheint mir das Gemälde Venus und Amor zu sein.
Dieser Titel behauptet etwas, was das Gemälde vorsätzlich nur zum Teil einlöst: In der Spiegelung - und das heißt auf dem Kopf stehend - sehen wir die vollständigere Version des Motivs; angeschnitten ist das Urbild aus der wirklichen Welt, in diesem Falle so extrem, daß man nur die Beine der Frauenfigur bis zum Knie sieht – sonst nichts. Im Wasserspiegel sehen wir die zeitgenössisch bis zeitlos in ein kurzes Kleidchen gewandete Frau, von ganz irdischer Schönheit, sicherlich wohlproportioniert, aber nicht unbedingt göttlich. An ihrer Seite steht in Siegerpose ein nackter geflügelter Knabe, mit hoch erhobenem Haupt, triumphierend die Hand mit dem Pfeil nach oben gereckt, in der anderen lässig den großen Bogen haltend. Wenn wir die Frau dem Titel entsprechend als Venus akzeptieren, dann ist der kleine Amor ihr Sohn. Da die Frau aber in Wirklichkeit kein Kind an der Hand führt, könnte man das Motiv auch als bildgewordenen Kinderwunsch interpretieren. Oder ist es eher ein Traum von Amor als Personifikation der Liebe, die, nun ja, vielleicht letztlich auch zur Erfüllung des Kinderwunsches führen könnte?
Wie so oft in Tsends Bildern ist die Spiegelwelt so etwas wie eine Traumwelt – eine erinnerte, phantasierte oder ersehnte Wirklichkeit – die Zeitrichtung ist nicht vorgegeben, ob es also Bilder der Vergangenheit oder einer möglichen Zukunft sind, bleibt ungewiss. Klar ist nur, daß sie, die Gespiegelten, nicht dieselbe physikalische Wirklichkeit besitzen wie die anderen Figuren, die sowohl in der Spiegelung als auch außerhalb sichtbar sind. Das Phänomen des Spiegelns hat bei Tsend erstaunlicherweise aber ganz naturalistische Ursprünge, es entstammt einer genauen Natur- und Landschaftsbeobachtung. Die kann natürlich in allen wässrigen Gegenden der Welt stattfinden – aber angetan hat es dem Künstler insbesondere das norddeutsche Wattenmeer. Wohl weil sich da das flache und weite, wenig bewegte Wasser bis zum Horizont dehnt, beinahe schon wie eine Wasserwüste aussieht. Ein Schlüsselwerk ist dabei für mich das Gemälde mit dem Titel Strandbad, in dem eine Gruppe von hoch aufgeständerten Häusern mitten im Wasser steht und sich entsprechend nach unten hin gespiegelt wiederholt. Diesmal aber ganz realistisch verdoppelt und so, daß die Spiegelung weniger deutlich ist und sich im wahrsten Sinne des Wortes verschwommen zeigt.
Von hier ist es malerisch nur ein kleiner, wenn auch geographisch ein gewaltiger Schritt zu Tsends anderen, mongolisch inspirierten Landschaftsbildern. Man sollte nun nicht den Fehler begehen zu glauben, daß das naturalistische Wiedergaben existierender Gegenden seien. In einem ersten Schritt tilgt der Künstler nämlich alles Zufällige, vor allem alles Menschengemachte aus diesen Bildern – abgesehen von den Wegen, die die Tiefenerstreckung zum Horizont perspektivisch erst richtig erlebbar machen. Aber wenn auch sonst kein Baum und kein Strauch dort stünde, auf jeden Fall wären da normalerweise eine menschliche Behausung, gleich ob Haus oder Jurte, Maschinen oder Müll, Menschen oder Tiere zu sehen. Tiere kommen oft und wie nachträglich hineincollagiert dann doch wieder in diesen Landschaften vor, mehr oder minder symbolisch aufgeladen. Wie z.B. in dem Bild mit dem für mich unaussprechlichen Titel Zulegtiin denj. Da steht eine Herde von Pferden dicht gedrängt fast kreisförmig beieinander, eine Insel aus Leibern in the middle of nowhere, vor leerem blassblauem Himmel auf kargem Steppenboden; das Sinnbild einer kreatürlichen Gemeinschaft und ihres Zusammengehörigkeitsgefühls, sei es nun Familie, Stamm oder Herde. Was man an diesem Gemälde unter anderem auch gut studieren kann, ist, wie ganz und gar nicht naturalistisch Tsend in Wahrheit viele seiner Landschaften gestaltet, insbesondere die weiten Ebenen der Steppenbilder. Da sieht man nämlich sowohl direkte Einflüsse seines Lehrers Kuhna, wie auch Spätfolgen des Pointillismus hervorschimmern, so sehr lösen sich grasbewachsene Ebenen in zart und bunt flirrende Flächen aus lauter Pinselstrichen auf.
Von dort ist es auch ganz einfach zu erklären, woher diese scheinbar ganz anders gearteten ungegenständlichen Bilder des Künstlers herkommen, denen man die naturverbundenen Titel wie Rosenfeld, Tau, Nachtstück oder Frühling im ersten Moment gar nicht abnimmt. Die Übergänge sind fließend. Ganz buchstäblich können wir das studieren, wenn wir uns noch einmal zurück- und dem Bild des Strandbades zuwenden. Die gespiegelten Stelzenhäuser hier sind nicht bloß von Wind und Wellen bewegte Spiegelung, sondern lösen sich auf in wirklich dünnflüssig fließende Farbe, die das flüssige Element des Wassers nicht illusionistisch wiedergibt, sondern materialiter vorführt, so daß dieses Bild, je weiter man nach unten blickt, desto abstrakter wird. Vollends abstrakt wird der Künstler dann in zwei seiner neuesten Arbeiten, die eine ganz wundersame Oberfläche besitzen und die man wirklich als Materialbilder begreifen muß. „Wolle auf Nessel“ lautet die schnöde technische Werkangabe - aber natürlich ist das nicht irgendeine Wolle, sondern echt mongolische Schafs- bzw. Yakwolle, die Tsend eingefärbt, erst in sich und dann mit dem Bildträger verfilzt hat. Das heißt: Auch hier verbindet der Künstler seine zwei Heimaten miteinander und kommt zu verblüffenden Ergebnissen.
Wir sehen: Gan Erdene Tsend ist ein echter Tiefstapler. Von wegen, „Zwei Welten“! Es gibt die abstrakten Gemälde, die abstrakten Materialbilder, die naturalistisch surrealistischen Ölgemälde, einerseits von Landschaften, andererseits von Spiegelungen, außerdem die Druckgraphiken, die motivisch meist Ableitungen aus den Gemälden sind, als überarbeitete Offsetdrucke existieren oder als aufwendige Serigraphien, und das Ganze in einer wahren Fülle von Gegensätzen, von Tieren und Menschen, Traum und Wirklichkeit, vielen Pferdestärken und einem Kilo Watt. Wirklich viele Welten auf einmal; wahr bleibt dennoch:
“One world is enough for all of us!”